Die deutsche Bundesbank liefert im aktuellen Monatsbericht (Januar 2023) zum Thema «Geldmengen-Preis»-Zusammenhang eine über alle Zweifel erhabene Stellungnahme.
Die Abhandlung beschreibt, wie die Geldpolitik der EZB sich inzwischen von der Zwei-Säulen-Strategie (die monetäre und finanzielle Analyse) verabschiedet hat.
Die Analyse spricht dafür, dass «hinter dem starken Geldmengenwachstum in der ersten Phase der Aufbau von Liquiditätsreserven stand, der für sich genommen nicht inflationär wirkt».
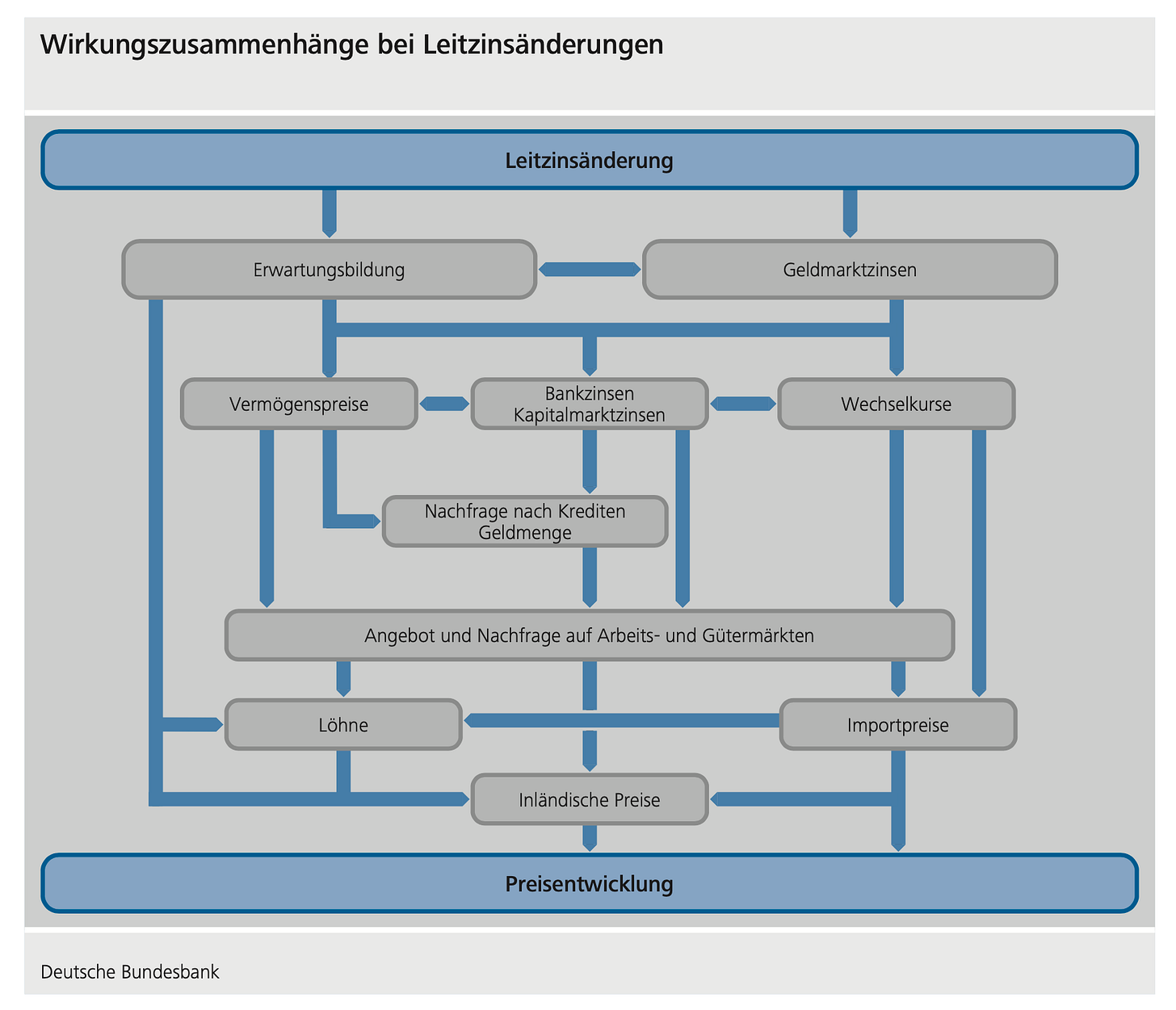
Bereits in den Anfangsjahren der Währungsunion erwies sich der Informationsgehalt des Geldmengenwachstums für die zukünftige Inflationsentwicklung in der kurzen Frist als begrenzt, so die Bundesbank.
Aber auch der langfristige Zusammenhang zwischen Geldmengen-Wachstum und Inflation hat sich laut Bundesbank abgeschwächt, wie die seit Mitte der 2000er Jahre veröffentlichten Studien zeigen.

Ohne um den heissen Brei herumzureden, lässt sich festhalten, dass die Bundesbank der Quantitätstheorie des Geldes ohne Wenn und Aber eine Absage erteilt.
Dies ist sicherlich eine Verlautbarung epischen Ausmasses.
Damit ist nämlich auch gesagt, dass die neo-klassischen Modelle des Bankwesens:
loanable funds,
fractional reserve banking,
money-multiplier
falsch sind.
Denn die Tatsache, dass Banken Geld schaffen, wenn sie Kredite vergeben, hat enorme Auswirkungen auf die Makroökonomie, wie Steve Keen in seinem lesenswerten Buch «The New Economics» unterstreicht.
Beispielsweise denken wir dabei an die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und die Beschäftigung.

Damit wird im Grunde genommen auch das Bild eines sich selbst regulierenden und stabilisierenden Marktsystems, welches ein mächtiger intellektueller und sogar emotionaler Anker für Mainstream-Ökonomen zu sein scheint, hinfällig.
Auf der anderen Seite des Atlantiks rückte auch die Fed rasch von ihren angeblich monetaristischen Arbeitsverfahren ab, und zwar nach dem Volcker-Experiment in den Jahren 1979-1982, wie Alan Blinder in seinem neuen Buch («A Monetary and Fiscal History of the United States») mit Nachdruck bekräftigt.
Mit den Worten von Ben Bernanke im Jahr 2016: "Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Geld- und Kreditaggregate seither keine zentrale Rolle bei der Formulierung der US-Geldpolitik gespielt haben".
Die deutsche Bundesbank hatte ja sogar im Monatsbericht April 2017 die Geldschöpfung ausführlich dargelegt, abseits der neoklassischen Makroökonomie, die ja Banken, private Schulden und Geld ignoriert.
Neoklassische Ökonomen pflegen diese Auslassung mit der Behauptung zu begründen, dass Banken und ihre Produkte, Schulden und Geld für die Makroökonomie weitgehend irrelevant seien.
Bereits die rein buchungstechnische Betrachtung der Entstehung von (Buch-)Geld verdeutlicht, dass die Kredit- und Geldschöpfung das Ergebnis komplexer Interaktionen zwischen Banken, Nichtbanken und Zentralbank ist.
Dabei hängt die Fähigkeit der Banken, Kredite zu vergeben und Geld zu schaffen, nicht davon ab, ob sie bereits über freie Zentralbankguthaben oder Einlagen verfügen. Vielmehr wird der Geldschöpfungsprozess durch eine Reihe von ökonomischen und regulatorischen Faktoren begrenzt.

Davor hatte die britische Notenbank, Bank of England (BoE) im Quarterly Bulletin 2014 Q1 erklärt, was Geld ist und wo es herkommt: Die Banken sind nicht auf Kundeneinlagen angewiesen, um Kredit geben zu können.
Die Realität der heutigen Geldschöpfung unterscheidet sich von der Beschreibung in manchen Wirtschaftslehrbüchern:
Anstatt dass die Banken Einlagen erhalten, wenn die Haushalte sparen, und diese dann ausleihen, werden durch die Kreditvergabe der Banken Einlagen geschaffen.
In normalen Zeiten legt die Zentralbank weder die Menge des im Umlauf befindlichen Geldes fest, noch wird das Zentralbankgeld in weitere Kredite und Einlagen "vervielfältigt".

Nun, da die Tatsache, dass Banken Geld schaffen, anerkannt ist, muss auch die Rolle des Finanzsektors bei der Entstehung von Vermögenspreisblasen und Finanzkrisen anerkannt werden.
Die Anleihekäufe der Zentralbanken sind für die Geldschöpfung irrelevant.



